„Identität ist in“: Gerade in Zeiten großer Veränderungen bekommt man das immer wieder zu hören: die eigene Identität bewahren. Das gilt gleichermaßen für den Einzelnen: Was kann er tun, um nicht in fortwährenden Veränderungen orientierungslos zu werden. Das gilt aber gleichermaßen für eine Organisation: Wie kann das Unternehmen, die Organisation das Team in Zeiten von Corona, Digitalisierung, agilem Arbeiten … seine Identität bewahren?
Doch was heißt es, die Identität bewahren? Was ist eigentlich Identität?
In einer ersten Definition lässt sich Identität definieren als bestimmte Eigenschaften, die sich vertikal (zu unterschiedlichen Zeiträumen) und horizontal (in unterschiedlichen Situationen) durchhalten. Bestände damit die Identität einer Beraterin darin, dass sie immer schon anderen Menschen geholfen hat? Oder die Identität eines Beratungsunternehmens darin, dass es schon immer Beratung (vielleicht auch systemische Beratung) angeboten hat?
Irgendwie ist das zu einfach. Es ist deshalb zu einfach, weil Identität hier auf einen, wie man sagt „deskriptiven“ bzw. beschreibenden Begriff reduziert wird. Aber wenn ich an meiner Identität zweifele, wenn eine Organisation sich nach ihrer Identität fragt, ist das nicht eine „neutrale“ Frage nach beschreibenden Merkmalen. Sondern es ist eher die Frage, wie ich oder wie wir uns verstehen, wie wir uns „definieren“. Das ist eine emotionale Frage: Die Antwort, die wir uns darauf geben, beeinflusst unsere Emotionen. Damit wäre „Identität“ ein Begriff, der ein komplexes emotionales Phänomen umschreibt – und nicht nur einfach irgendwelche Merkmale auflistet.
Doch wie lässt sich dann „Identität“ definieren? Ein Ansatz könnte sein, sich einem „Klassiker“ des Identitätsbegriffs zuzuwenden, nämlich George Herbert Mead, dessen nach seinem Tode veröffentlichte Vorlesung „Geist, Identität und Gesellschaft“ (1968) immer noch grundlegend für alle Identitätsdiskussion ist.
Mead unterscheidet zwischen „I“, „Me“ und „Self“. Grob übersetzt umfasst das „I“ die spontanen Einstellungen und Handlungen. Das „Me“ greift die Erwartungen anderer auf – aber zugleich gefiltert durch die eigene subjektive Brille. Konkret: Ich hätte Lust, nachmittags spazieren zu gehen, anstatt bei Videokonferenzen zu sein (das ist das „I“) – aber ich antizipiere zugleich die Erwartungen meiner Gesprächspartner, mit denen ich die Videokonferenz vereinbart habe (das „Me“). Wohlgemerkt: Es sind nicht die realen Erwartungen meiner Gesprächspartner (möglicherweise hätten sie gar nichts dagegen, wenn die Videokonferenz ausfällt) – sondern es sind meine „subjektiven Deutungen“, meine Interpretation ihrer Erwartungen.
Die Herausforderung ist, beide Seiten, das „I“ und das „Me“, in Einklang zu bringen – eben das bedeutet im Anschluss an Mead Identität (Mead spricht hier von dem „Self“). Identität, so lässt sich damit formulieren, ist das Herstellen eines Gleichgewichts zwischen den individuellen Bedürfnissen und Einstellungen und den antizipierten Erwartungen der Gesellschaft bzw. einzelner Gruppen.
Dieser „interaktionistische“ Identitätsbegriff hat für die Frage nach individueller oder organisationaler Identität entscheidende Konsequenzen:
- Identität ist kein statischer Zustand, der sich über verschiedene Zeiträume und in verschiedenen Situationen (Rollen) hin durchhält, sondern Identität ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Prozesses. Identität ist immer wieder neu herzustellen. Herstellung von Identität wird insbesondere dann zum Thema, wenn Traditionen brüchig werden oder in kritischen Lebensereignissen.
- Identität ist nicht mithilfe von Merkmalen beschreibbar, sondern ist immer nur unmittelbar erfahrbar. Identität, so ließe sich modern formulieren, ist ein Evidenzbegriff, die Erfahrung von Identität eine Evidenzerfahrung: Ich spüre unmittelbar, ob ich mit mir im reinen bin.
- Identität hat verschiedene Facetten, eine kognitive, eine emotionale und eine auf der Handlungsebene (eine konative):
- Auf kognitiver Ebene mögen es bestimmte Glaubenssätze sein, zum Beispiel „Die Arbeit hat Vorrang“ oder „es kütt wie es kütt“,
- auf der emotionalen Ebene (und sie dürfte hier die wichtigste sein) das Gefühl, ich bin mit mir im reinen,
- auf der konativen, der Handlungsebene, wird Identität oft dabei deutlich, was ich gerne tue, dass ich etwas tue, für das ich mich begeistern kann – ohne im Anschluss ein schlechtes Gefühl zu haben.
- Wenn Identität vor allem ein emotional gespeichertes Konzept ist, dann, dann ist Identität nicht begrifflich fassbar. Identität wird emotional gespeichert – und das bedeutet, sie wird deutlich in Bildern und Geschichten. Hier schließt sich der Bogen zu Ansätzen einer narrativen Identitätsforschung (z.B. Heide von Felden): Es sind Geschichten, die die Identität einer Person oder die Identität einer Organisation verdeutlichen.
- Es gibt keine „Identitätstechnologie“ – Identität lässt sich nicht technisch herstellen durch Anweisungen, gut zu leben, das Leben zu genießen. Sicherlich, auch das kann zur Identität gehören, schöne Momente zu genießen – aber jeder weiß, dass das nicht „planbar“ und steuerbar ist, und dass gerade der Versuch dazu oft zu Problemen führt. Sicher, es können Anstöße gegeben werden. Identität herstellen, bedeutet die eigene Situation zu reflektieren, die Erwartungen, die von außen an mich herangetragen werden, aber auch auf die emotionalen Signale in mir zu spüren. Identität herzustellen, bedeutet auch, sich die Geschichten der eigenen Person oder die der Organisation bewusst zu machen.
Ein Gleichgewicht zwischen den eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen auf der einen Seite und den Erwartungen anderer herzustellen, ist immer schon Aufgabe im Coaching: eine andere Person zu unterstützen, sich bewusst zu werden, wie weit eigenes Empfinden und Erwartungen anderer im Gleichgewicht sind – und Möglichkeiten zu finden, dieses Gleichgewicht herzustellen.
Das Gleiche ist aber auch Aufgabe von Organisationen: Identität kann nicht von außen vorgegeben werden. Es reicht auch nicht, sie in einem Leitbild zu beschreiben. Identität einer Organisation ist auch nicht die Summe der Identitäten der einzelnen Mitglieder. Sondern gemeinsame Identität einer Organisation, eines Teams entsteht immer nur in einem gemeinsamen Aushandeln: im Finden eines gemeinsamen Sinns (bei dem sich alle wiederfinden), beim Entwickeln eines Wir-Gefühls, beim gemeinsamen Lösen von Herausforderungen.
Zum Schluss noch eine Anregung, wenn Sie sich weiter mit den Grundlagen des Identitätsbegriffs beschäftigen möchten:
Heinz Abels (2017): Identität. 3. Aufl. Wiesbaden: Springer
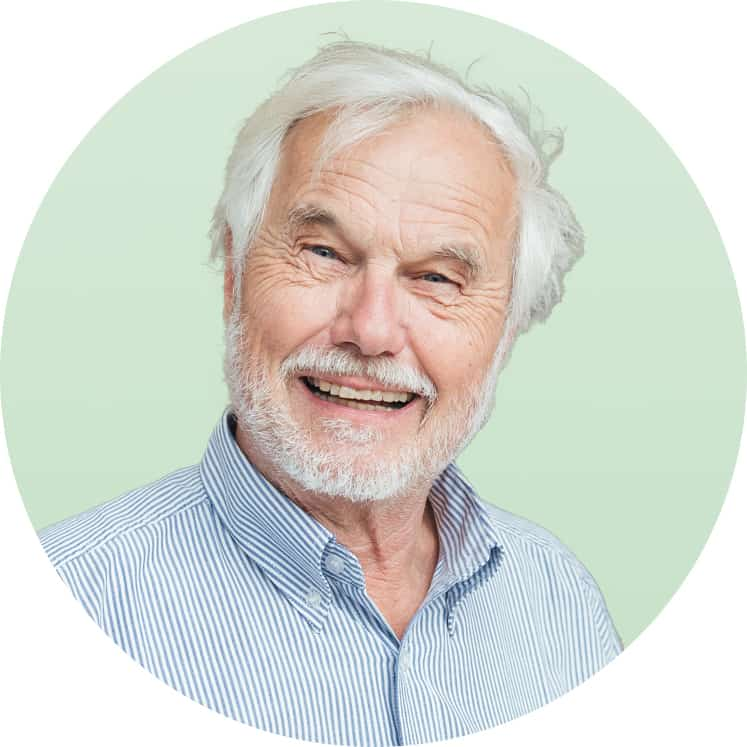
Autor
Prof. Dr. Eckard König
emeritierter Professor an der Universität Paderborn mit dem Arbeitsschwerpunkt Weiterbildung/Organisationsberatung. Er hat langjährige internationale Erfahrung bei der Beratung von Organisationen und führt – zusammen mit Gerda Volmer – seit über 25 Jahren eine der erfolgreichsten Ausbildungen in Systemischer Organisationsberatung durch.
Kommentare
Lieber Eckart, liebe Gerda, danke für die theoretischen Grundlagen zu meinen inneren Überzeugungen!
Zwei Sätze resonieren besonders:
1. "Identität ist kein statischer Zustand, (...) sondern Identität ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Prozesses. Identität ist immer wieder neu herzustellen.
2. Die emotionale Ebene "dürfte hier am wichtigsten sein": Ich bin mit mir im Reinen.
Wir, die aufgrund einer Krankheit einen geliebten, ausfüllenden Beruf aufgeben müssen; Dinge, die uns immer ausgemacht haben in unserem Selbstverständnis aufgeben müssen, befinden uns kontinuierlich in diesem Prozess. Wer bin ich? Wer will ich sein? Was macht mich im Innersten aus? Und wie verhalte ich mich dazu in meinem System?
Das fordert viel und macht auch sehr reich und innerlich frei.
Das Buch schaue ich mir an und hoffe, es gibt ein Eboek :). Liebe Grüße an euch, Anne aka SEHHELDIN

Kommentar schreiben